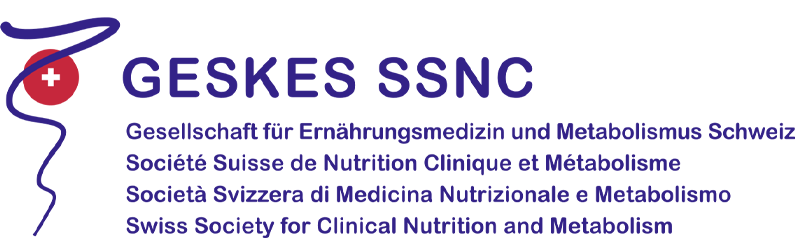Nierentransplantation
Die Transplantation stellt durch ein neues Organ die Funktion der Niere wieder her. Einige Aspekte, welche in der Prä- und der frühen und späten Posttransplantationsernährung sowie der Langzeiternährung beachtet werden sollen, sind hier beschrieben 1.
Der Nährstoffbedarf muss individuell an den metabolischen Zustand angepasst werden.
Ziele der Ernährungstherapie
- Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Ernährungszustandes
- Vermeidung von Mangelernährung, Übergewicht oder von Nährstoffdefiziten
- Suppression der Nebenwirkungen der Steroidtherapie durch vielseitige und abwechslungsreiche Ernährung
Der Energie- und Proteinbedarf sollte, wenn immer möglich mit oraler Ernährung gedeckt werden. Falls mit Anreicherung, Zwischenmahlzeiten oder Trinknahrungen weniger als 75% des Bedarfs gedeckt werden, sollte auf enterale Ernährung als Ergänzung eskaliert werden. Eine komplementäre parenterale Ernährung ist indiziert, wenn weniger als 75% des Bedarfes durch orale und/oder enterale Ernährung gedeckt wird.
Patient:innen dieser Gruppe sind metabolisch und ernährungstherapeutisch sehr heterogen und komplex. Daher können nur generelle Empfehlungen gegeben werden 2.
Prä-Transplantation
In der Ernährungstherapie vor der Nierentransplantation ist das primäre Ziel eine schwere Malnutrition zu beheben und Volumenüberladung und Elektrolytentgleisung zu verhindern. Risikofaktoren für Komplikationen, wie unkontrollierter Diabetes mellitus, Übergewicht, Rauchen, starke Dyslipidämie und Bluthochdruck, sollten sorgfältig korrigiert und therapiert werden. Bei übergewichtigen Patient:innen sollte der BMI nicht höher als 35 kg/m2 sein. Assessment des Kalzium-, Phosphat-, Nebenschilddrüsenhormon-, Knochenstatus und des Kalziumsalzes und Vitamin D Spiegels sollte durchgeführt werden. Durch eine ausreichende Mikronährstoffversorgung kann das Infektionsrisiko reduziert, die Wundheilung verbessert und die Muskelmasse besser erhalten werden 3, 4.
Transplantation
Während der Transplantation sollen milde wie auch starken Überhydrierung unbedingt verhindert werden, da sonst häufig Flüssigkeitsretentionen auftreten. Eine strikte Kontrolle der Elektrolyten, wie Kalium, Phosphat und Magnesium, und des Säure-Basen Gleichgewichts ist unerlässlich. Die nach der Operation verabreichten Kortikosteroide erhöhen den Proteinkatabolismus. Zusätzlich tritt auch in nicht-diabetischen Patient:innen oft eine Hyperglykämie auf. Eine strikte Kontrolle der Glukosekonzentration kann das Risiko auf Post-Transplantation-Diabetes Mellitus verringern. Weiter kann sich im Zusammenhang mit Immunsuppressiva eine Hypophosphatämie oder Hypomagnesiämie entwickeln.
Frühe Post-Transplantationsphase
Das chirurgische Trauma bei einer Nierentransplantation wird als mild eingestuft. Die Darmfunktion ist meist schnell wiederhergestellt und eine künstliche Ernährung im Normalfall nicht nötig. Mildes chirurgisches Trauma, Mangelernährung, hochdosierte Steroidtherapie und potentielle Verzögerungen in der Nierenfunktionswiederherstellung machen transplantierte urämische Patient:innen anfällig für ein Protein-Energy Wasting. Hohe Proteineinnahme (ca. 1.3 g/kg Körpergewicht) und körperliche Aktivität können vor allem bei hohen Steroidhormondosen die Protein- und Energieverluste lindern 3, 5. Einige Patient:innen benötigen eine Hämodialyse aufgrund einer verzögerten Transplantatfunktion. Der Mikro- und Makronährstoffbedarf dieser Patient:innen gleicht häufig noch denjenigen von akuten Nierenversagen Patient:innen 4.
Späte Post-Transplantationsphase
Je nach Grunderkrankung treten unterschiedlich starke Komplikationen, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit verbundene metabolische Folgen, nach einer Nierentransplantation auf. Enge Überwachung der metabolischen Entwicklungen ist notwendig und individuelle therapeutische Massnahmen spezifisch auf folgende häufige Komplikation müssen umgesetzt werden:
- Stadium der Niereninsuffizienz, häufig 3-4 (KDIGO)
- Glukoseintoleranz Beeinträchtigung oder Diabetes Mellitus
- Gewichtszunahme, Übergewicht oder metabolisches Syndrom
- Anhaltender Bluthochdruck
- Renaler Phosphatverlust bei vorbestehendem Hyperparathyroidismus, "Hungry Bone", Mineral Bode Disease.
- Anhaltende metabolische Azidose
- Dyslipidämie: Charakterisiert durch hohe Total- und LDL-Cholesterinwerte 3. Ursachen dafür sind Steroide, Nierenfunktionsstörung, Proteinurie, Cyclosporin, erhöhtes Körpergewicht und unangemessene Nahrungsaufnahme 6.
- Anhaltende Anämie
- Anhaltender Protein Katabolismus
Die Ernährungsempfehlungen für Nierentransplantationspatient:innen, welche erneut in das Spital eintreten aufgrund akuter Erkrankung sollen wie Patient:innen mit akutem Nierenversagen behandelt werden (Link Kapitel Akute Nierenschädigung oder chronische Niereninsuffizienz mit akuter Erkrankung).
Medikamente/Supplemente
- Vermeidung von Lebensmittelinteraktionen mit Immunosuppresiva (z.B. Grapefruit, Granatapfel, Pomelo, Sternfrucht, Johanniskraut).
- Bei intravenösem Cyclosporin scheint eine Wechselwirkung zwischen dem Lösungsvermittler und dem Lipidstoffwechsel möglich 4.
- Teplan, V., et al., Nutritional consequences of renal transplantation. J Ren Nutr, 2009. 19(1): p. 95-100.
- Phillips, S. and R. Heuberger, Metabolic disorders following kidney transplantation. J Ren Nutr, 2012. 22(5): p. 451-60.e1.
- Toigo, G., et al., Expert working group report on nutrition in adult patients with renal insufficiency (Part 2 of 2). Clin Nutr, 2000. 19(4): p. 281-91.
- Sobotka, L., BASICS IN CLINICAL NUTRITION. 2020, [S.l.]: GALEN.
- Horber, F.F., et al., Thigh muscle mass and function in patients treated with glucocorticoids. Eur J Clin Invest, 1985. 15(6): p. 302-7.
- Teplan, V., et al., Age and changes in dietary habits affect hyperlipoproteinemia after kidney transplantation. Cas Lek Cesk, 1999. 138(4): p. 111-5.
Autorenschaft:
Valentina Huwiler, PhD, Ernährungswissenschaftlerin, Inselspital Bern
Cecilia Czerlau, MD, Nephrologin, Inselspital Bern
Dominik Uehlinger, MD, Nephrologe, Inselspital Bern